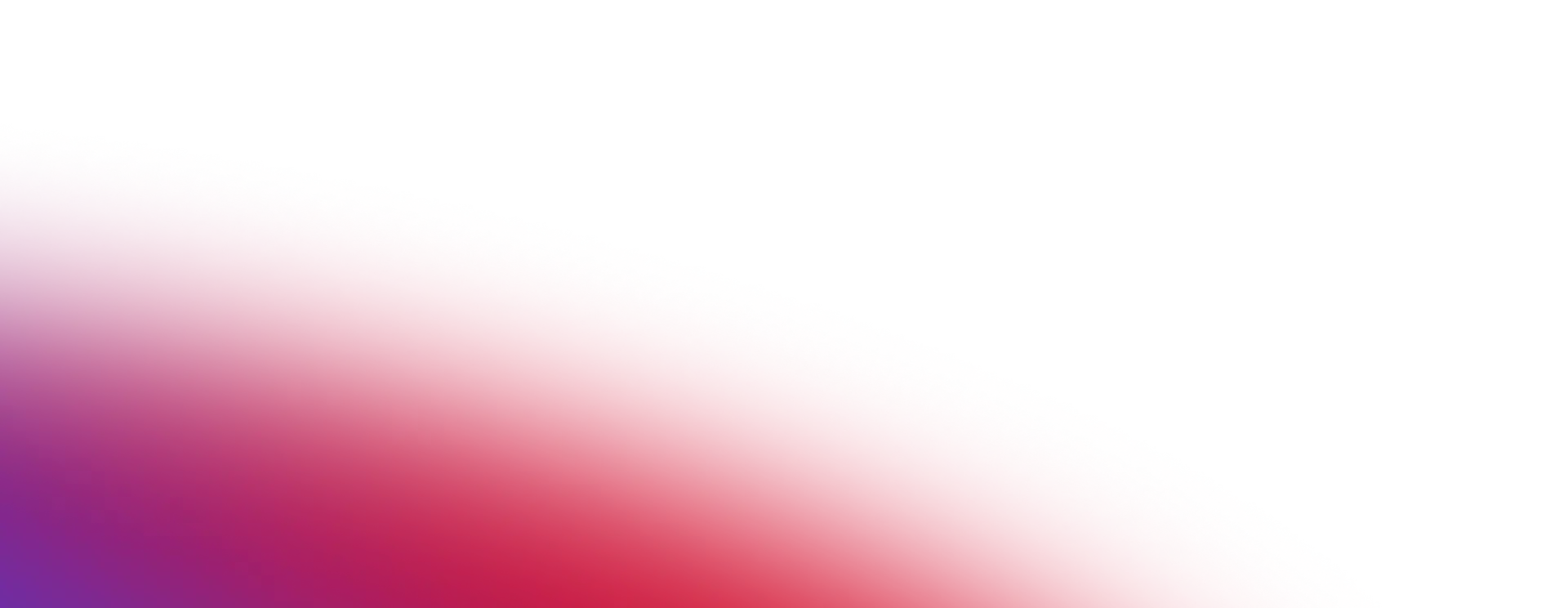»Ich bin nicht besser als Sie, ich habe nur mehr Erfahrung.« Das habe die Pianistin Elisabeth Leonskaja, so erzählt eine Musikerin, einmal zu Beginn eines Meisterkurses zu den Teilnehmenden gesagt. Dieser Satz klänge vielleicht beinah unverschämt bescheiden, wenn nicht der Begriff unverschämt im Zusammenhang mit Leonskaja, sagen wir, beinah unverschämt klänge: sowohl was ihre Person als auch was, das Wichtigste, ihr Musizieren betrifft. Bliebe also bescheiden. Aber auch darin liegt doch etwas Unpassendes, der Hauch einer aus der Zeit gefallenen männlichen Gönnerhaftigkeit, aus deren Geist Joachim Kaiser vor einem halben Jahrhundert in seinem Buch Große Pianisten in unserer Zeit (alle Geschlechter mitgemeint, zumindest ein bisschen) einen Abschnitt überschrieb: Damen, die sich nicht vordrängten. Elisabeth Leonskaja würde vermutlich auch dazu nachsichtig lächeln. Denn wenn überhaupt etwas sich „vordrängen“ sollte, wäre es die Musik, niemals die Interpretierenden. Aber drängen, das wäre schon wieder so ein Begriff, der irgendwie …
„Ist halt viel Arbeit“: noch ein Zitat. So antwortete die Pianistin auf die Frage, was jenes so deutlich hör- und spürbare „gewisse Etwas“ ihrer Schubert-Interpretationen ausmache. Und auch das ist höchstens halb kokettiert. Eine Professur, wie sie professionellen Musikern im Auf und Ab der Laufbahn eine gewisse materielle Sicherheit gibt, lehnte Leonskaja seit ihrer Übersiedlung aus der Sowjetunion nach Wien im Jahr 1978 stets ab. Denn ernsthaftes Arbeiten erfordert nun mal viel Zeit und absolute Konzentration. Als dauerreisende Konzertpianistin, die Leonskaja bis heute ist, beschränkt sie sich daher auf Meister- und, sprechen wir’s aus, Meisterinnenkurse.
Wenn Leonskaja dann aber doch eines der Geheimnisse ihres Klavierspiels nennt: „Man muss im Takt spielen“ – so darf man diesen Takt wohl im mehrfachen Sinn begreifen. Vielleicht würde sie schon den Begriff des Geheimnisses anzweifeln, zumindest als ihres Geheimnisses. Ähnlich, wie sie es im Gespräch mit dem Wiener Kritiker Walter Weidringer tat, der sie auf ihre Auszeichnung als Priesterin der Kunst durch die Republik Georgien ansprach: „Dafür kann ich aber nichts!“ Dann gewann sie dem Begriff allerdings doch etwas ab, indem sie, statt des Weihevollen oder Zelebrierenden, das Dienende als Wesentliches des Priesteramtes betonte. In diesem Sinn wirkt es völlig unnebelig, wenn Leonskaja schließlich doch die Musik als „heilige Kunst“ bezeichnet. Ein Geheimnis, dem man sich mit Takt nähern sollte.
Und eben im Takt. Das gilt für ihren Schubert, ebenso für ihren Mozart und Beethoven. Wenn Leonskaja gern das Gipfeltripel der letzten drei Sonaten Opus 109 bis 111 in einem pausenlosen Rezital aufführt, ist dabei doch nichts von dem Beethoven-Hohepriesteramt zu spüren, das gerade in Deutschland einstmals angesagt war. Geht es hier etwa nicht um sogenannte letzte Dinge? Doch, gut möglich. Aber mit Dezenz.
Auch der Begriff „russische Klavierschule“ könnte in die Irre führen, sofern er nicht einfach rein biographisch gemeint ist, sondern im klischeehaften Sinn des technisch perfekten Tastenlöwentums oder gar der mächtigen Pranke und weit waltenden Rubatos. Doch zweifellos gehörte zu Leonskajas bedeutenden Wegweisern und später -gefährten ein Pianist wie Swjatoslaw Richter. Und „russische Schule“ im besten Sinn ist Leonskajas Spiel als harmonische Verbindung von Technik und Ausdruck, in der sich weder das eine noch das andere vordrängt. Also durchaus eine pianistische Qualität oberhalb aller nationalen Kategorien.
Leonskajas Emigration nach Wien vor fast fünfzig Jahren muss eine turbulente Angelegenheit gewesen sein, eigentlich hatte sie unter schwierigen Umständen mit einem sowjetischen Ausreisevisum nach Israel ziehen wollen. In den Verwerfungen der Gegenwart, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine, ruft es bei Verehrern der Pianistin ebenso wie bei einigen langjährigen Weggefährten (etwa dem Geiger Gidon Kremer) Irritationen hervor, dass ausgerechnet Leonskaja zu den Musikern gehört, die nach wie vor in Russland auftreten. Das kann man problematisch finden; abwegig wäre es allerdings, hierin ein Bekenntnis zur russischen Aggressionspolitik zu sehen und auf ein Verhältnis zum Heimatland zu schließen, das affirmativ wäre, nicht ambivalent. Auch ließe sich darauf hinweisen, dass am Grunde eines Lebens, das heute so in sich ruhend scheint, erhebliche Unruhigkeiten liegen können: beginnend damit, dass die jüdische Familie von Leonskajas Mutter einst aus Odessa (in der damaligen Ukrainischen Sowjetrepublik) vor antisemitischen Pogromen floh, so dass die Tochter Elisabeth 1945 in Tiflis geboren wurde, der Hauptstadt des heute unabhängigen Georgien. Man kommt ja nicht einfach irgend „woher“, die Welt ist komplizierter.
Möglicherweise machen gerade solche – spekulierten – Ambivalenzen Leonskaja auch zu einer Pianistin mit einer besonderen Ader für Schostakowitsch. Denn was ist schon eindeutig im Leben und Werk dieses Komponisten, der einerseits als sowjetischer Staatskünstler schlechthin galt, andererseits als Dissident durch und durch betrachtet wurde? Im beklemmend-berauschenden Finale seines Klavierquintetts g-Moll aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs etwa herrscht, versteckt, ein jüdisches Thema, eine bedeutsame Wahl angesichts des nazideutschen Völkermords an den Juden natürlich, aber heikel eben auch unter der Herrschaft von Stalins eigenem Antisemitismus.
So wäre zu wünschen, dass man sich auch als Hörer Leonskajas Kunst und Person mit Takt und Dezenz nähere, immer eher fragend statt lauthals oder vorschnell antwortend. Zuhörend. Und, bitte sehr, bewundern darf man dann schon auch, diese Pianistin mit der unbefangenen, ja jugendlichen Ausstrahlung, die den gern benutzten Begriff Grande Dame etwas albern klingen lässt. Ein bisschen wie aus einer anderen Welt liest sich auch das liebevolle kleine Denkmal zu Lebzeiten, das der Dichter Wolf Wondratschek (als Lyriker und Boxer ein seltenes Tier im deutschen Kunstbetrieb) Leonskaja 2018 in seinem Buch Selbstbild mit russischem Klavier setzte:
Was für eine stattliche, beeindruckende Erscheinung sie noch immer ist, das steht fest, über welche Energie sie noch immer verfügt, wenn sie auftritt, nicht der geringste Verschleiß, und dann, das hatte ihm vor vierzig Jahren in Moskau schon gefallen, ihre Mähne, die sie bis heute hat und die sie so attraktiv erscheinen lässt. Sie scheint es nicht eilig zu haben, dem jungen Gemüse das Podium zu überlassen, und das ohne jeden unangebrachten Ehrgeiz. Sollen sie ihre Schönheitswettbewerbe unter sich ausmachen. Sie kämpft nicht, sie lässt, was sie tut, geschehen.
Würde jüngeres Schreibgemüse heute so über eine Frau schreiben? Eher nicht, und das ist vielleicht auch gut so. Aber Leonskaja würde dazu vermutlich freundlich lächeln. Oder im russisch gefärbten Wienerisch freundlich-amüsiert kommentieren. Im Übrigen kann man auch das, was wer anders über einen so dahinsagt oder daherschreibt, einfach geschehen lassen. Wie, viel wichtiger, die großen Dinge in der Musik.
Albrecht Selge